
Geschichte der Posaunenchöre:
Diese Seite befindet sich im Aufbau, d.h. sie ist noch nicht fertig.

Sie wird auch nie fertig, denn Geschichte wird immer geschrieben und ist immer Baustelle.

Ein Satz vorweg:
Die Geschichte der Posaunenchöre gibt es eigentlich gar nicht, denn jeder Posaunenchor hat seine Geschichte, die mit den jeweiligen BläserInnen geschrieben wird. Es gibt Posaunenchöre mit 4 Bläsern, aber auch welche mit 150 Bläsern. Aber es gibt doch einige viele markante Menschen in der Posaunenarbeit. Da war es: Das Wort "Arbeit".
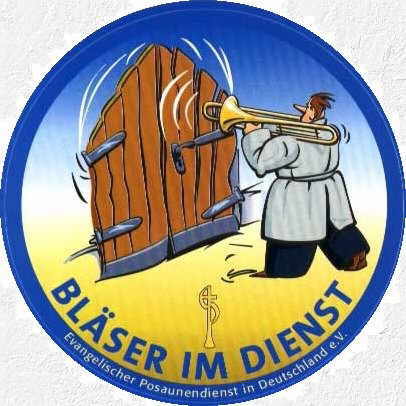
Wieso ist Musik Arbeit ????
Weil die Posaunenarbeit, Arbeit im Reich Gottes ist.
Halleluja — lobt den Herrn
 Lobt Gott in seinem Tempel!
Lobt Gott in seinem Tempel!
Lobt ihn, den Mächtigen im Himmel
Lobt ihn für seine gewaltigen Taten
Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich!

Lobt ihn mit Harte und Zither!
Lobt ihn mit Tamburin und Tanz.
Lobt ihn mit Saitenspiel und Flötenklang
 Lobt ihn mit Zimbelschall und
Paukenschlag!
Lobt ihn mit Zimbelschall und
Paukenschlag!
Alles, was lebt, lobe den Herrn
Halleluja
Dieser Psalm rechtfertigt nicht nur unsere Bläserarbeit, sondern ist auch Verpflichtung. Unseren Auftrag haben wir aus mehreren Stellen in der Bibel.
Diesen Auftrag haben Posaunenchorbläser und Posaunenchorleiter in den vergangenen Jahren/Jahrzehnten und auch bald Jahrhunderten immer wieder ernst genommen.
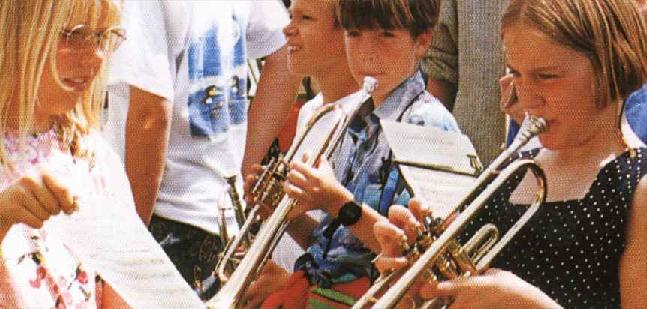
Die Bilder machen deutlich, dass Alte und Junge an dem Projekt " Posaunenchor " arbeiten. Es wäre anders auch gar nicht denkbar. Für eine Gemeinde kann das bedeuten, dass in einem Posaunenchor Jugend- und Familienarbeit gemacht wird, aber auch dass die Bläser neben des musikalischen Auftrages volksmissionarisch und diakonisch tätig sind. Genauso sind im Posaunenchor Menschen im " Mittelalter " von 20 - 50 Jahren gut aufgehoben. Dieses große Altersspektrum ist ein großer Schatz der Posaunenchöre. Nur so können die alten ( ernsten ) Lieder und Melodien neben den neuen - manchmal schwungvolleren - bestehen.
Die Instrumente in einem modernen Posaunenchor: hier klicken
| |
In
Ostwestfalen (Ravensberger Land) bricht eine sogenannte
"Erweckungsbewegung" aus und gewinnt schnell
viele Menschen. Bald gibt es ein Problem: Die Kirchen
werden zu klein! Beim Gottesdienst im Freien aber fehlt
die Orgel. Also kommt man auf den Gedanken, eine "transportable"
Orgel in Gestalt von Blechbläsern einzusetzen. Das ist
die Gründungsstunde der Posaunenchöre. |
| |
Die
ersten Posaunenchöre entstehen in Westfalen. Bald aber
auch an vielen anderen Stellen Deutschlands. Die beiden
Kuhlos (Vater Eduard und Sohn Johannes), beide Pastoren
in der Bielefelder Gegend, werden zu Gründungsvätern
und Wegbereitern der neuen Bewegung. Eine andere Wurzel der Posaunenarbeit liegt im östlichen Sachsen, und sie ist noch weit älter. Mit den "Böhmischen Brüdern", aus Glaubensgründen aus der Tschechei vertrieben, kamen nicht nur die ersten "Brüdergemeinen" nach Deutschland (zunächst Herrnhut), sondern auch die ersten Bläserchöre. |
| |
In
Deutschland gibt es annähernd 7.000 Chöre, die sich
freilich gegenüber den Gründungschören deutlich
verändert haben: Waren es anfangs nur geprüft-fromme
junge Männer, so spielen heute schon bis zu 50% Mädchen
und Frauen in den Chören. Ein Drittel der Mitspieler ist
unter 30 Jahre alt. Alle Altersgruppen sind vertreten und
alle sozialen Schichten. Es ist eine unvergleichliche
kirchliche Arbeit, sowohl von der Zahl als auch von der
Struktur gesehen. Eine starke und stabile Gruppe der
evangelischen Kirchen - und sehr ökumenisch orientiert! |
Entstehung
Zur Geschichte der
Posaunenarbeit
| 120.000 Menschen - Männer und Frauen, alte und junge - spielen heute in Deutschland in einem Posaunenchor. In fast jeder zweiten evangelischen Gemeinde, ob freikirchlich oder landeskirchlich, verrichten die Bläser inzwischen ihre Dienste. Die Posaunenchorbewegung zählt damit zu den größten Laienbewegungen des deutschen Protestantismus überhaupt. | Wo liegen die Wurzeln dieser klingenden Lebensäusserung unserer Kirche? Wie hat sie sich weiter entwickelt? Wer waren ihre Förderer? Wie sieht die Posaunenchorarbeit heute aus? Fragen auf die auch die meisten Bläser keine sicheren Antworten geben können. Deshalb soll hier diesen Fragen nachgegangen werden. Zunächst soll es um die Entstehung der Posaunenchöre gehen. |
Teil 1: Wie kam es
zu den Posaunenchören ?
| Im
vorigen Jahrhundert erfaßte eine "Erweckungsbewegung"
viele Gemeinden in Westfalen. Neues geistliches
Leben erwachte und äußerte sich in vielfältiger Weise,
darunter in einer besonderen Liebe und Freude am Singen,
am Lied. Wilhelm Ehmann schreibt in seinem Buch "Johannes
Kuhlo", daß die großen religiösen Bewegungen
immer auch Singbewegungen waren. Man traf sich in großer
Zahl zu Gottesdiensten und anderen geistlichen
Versammlungen. Pastor Volkening, die treibende
Kraft der Erweckung in Westfalen, erkannte bald, wie
wichtig ein geeignetes Instrumentarium für die Führung
und Begleitung des Gesanges einer großen Gemeinde war
und welche kräftigen Impulse für das geistliche Leben
der Gemeinden davon ausgehen könnten. Bei einem Besuch lernte er eine blasende Knabenkapelle kennen und sah, daß ein Blechblasensemble seinen volksmissionarischen Bestrebungen in besonderer Weise entgegenkam. Er gründete 1843 in Jöllenbeck bei Bielefeld den ersten Posaunenchor in dieser Region. Seinen Namen erhielt der Chor wegen seiner Besetzung mit einem Klappenhorn und drei Posaunen. Es ist aber auch denkbar, daß die Bezeichnung "Posaunenchor" auf eine Anregung seitens der Posaunenchor zurückgeht, denn zu den Versammlungen der westfälischen Gemeinden kamen immer wieder auch Prediger aus Herrnhut, und |
dort kannte man schon seit etwa 1730 Bläserchöre mit verschiedenen Instrumenten, darunter Waldhörner und Posaunen.1764 erscheint in einem Herrnhuter "Ritual" die Benennung "Posaunenchor". Somit dürfte dieser Name zuerst in der brüderischen Bläserarbeit verwendet worden sein. Bei ihm ist es für die evangelischen Bläserchöre bis heute geblieben, obwohl sie längst nicht nur mit Posaunen, sondern auch mit etlichen anderen Blechblasinstrumenten besetzt sind. |
Teil 2: Wichtige
Förderer der Posaunenchorarbeit
| Im
ersten Teil der Geschichte der Posaunenchorarbeit
ging es um die Entstehung der Posaunenchöre. 1843
gründete Pastor Volkening in Jöllenbeck den ersten
Posaunenchor. Bereits 100 Jahre vorher um 1730 gab es im
Bereich der Herrnhuter Brüdergemeine
Bläserchöre, so daß es 1812 mit dem Königsfelder Chor
zur ersten Gründung in Baden kam. Die Idee Volkenings
wurde auch in anderen Gemeinden Westfalens und darüber
hinaus aufgegriffen und entwickelte sich zu einem
wichtigen Teil gemeindlicher Aufbauarbeit, vor allem im
Kinder- und Jugendbereich und in der
altersübergreifenden Arbeit in einer Gemeinde. Pastor Volkening übergab dann die Arbeit an den jungen Posaunenchören an Pastor Eduard Kuhlo, der den Bläsern eine tragfähige Grundlage in enger Anlehnung an das christliche Sangeswesen jener Zeit verschaffte. Eduard Kuhlo (1822-1891) erhielt in seinem Sohn Johannes einen tüchtigen Gehilfen und Mitarbeiter. Gemeinsam gaben sie Posaunenbücher heraus, die sie mit Vokalsätzen füllten, denn der Gesang erschien ihnen - ganz im Sinn ihrer Zeit - als das höchste musikalische Ideal. Nach dem Tod des Vaters wurde Pastor Johannes Kuhlo (1856-1941) zum Präses der Minden-Ravensberger Jünglings-, Jungfrauen- und Posaunen-Vereine gewählt. Auch in anderen Regionen Deutschlands wurden im Lauf des letzten Jahrhunderts Posaunenchöre gegründet, meist eingebunden in die örtlichen Jünglingsvereine, geprägt durch die mehr und mehr verbreiteten Kuhlo-Posaunenbücher. Johannes Kuhlo war die prägende Gestalt der Posaunenchöre in den ersten Jahrzehnten unsres Jahrhunderts. Als Bläser (Kuhlo - Horn), Chorleiter und Herausgeber wichtiger Noten- und Schulungsliteratur etc. für den ganzen deutschen Sprachraum gab er den Posaunenchören wichtige Hilfsmittel an die Hand. Nach dem 2. Weltkrieg führte dann Wilhelm Ehmann diese Arbeit weiter. Ehmann, selbst noch Bläser im Kuhlo-Horn-Sextett und dadurch sicherlich geprägt, war von Hause aus Kirchenmusiker, Musikwissenschaftler und Gründer sowie Leiter der Kirchenmusikschule der Evang. Kirche von Westfalen in Herford. Er blieb aber nicht beim Stand Kuhlos stehen, sondern förderte zwei wesentliche Neuerungen: |
Johannes
Kuhlo mit seinem Flügelhorn · Die Bläser bekamen neue Literatur auf die Notenpulte. Ureigenste Bläsermusik aus dem 17. Jahrhundert, die bis dahin allgemein unbekannt war, sowie neue Literatur, spezielle Auftragskompositionen (choralgebundene und freie Bläserliteratur) wurden von ihm erprobt und herausgegeben.
Um noch einmal auf Kuhlo zurückzukommen, und ihn
etwas näher zu beschreiben sollen am Schluß zwei Zitate
von ihm stehen. Bezeichnend für Kuhlo ist z. B. in
Briefen seine Anrede, die oft so begann: "An die
Mitarbeiter an Psalm 150!" In diesem Psalm
heißt es: "Lobet den Herrn mit Posaunen!" (Ps.
150, 3). "Gott
allein die Ehre!" |
Der
charakteristische Schriftzug von Johannes Kuhlo:

Verfasser D. Joh. Kuhlo,
Pastor "i. U. d. u." (= in Unruh, dauernd unterwegs)
Teil 3: Die Arbeit
und die Musik eines Posaunenchors
| In
den ersten beiden Teilen ging es um die Geschichte der
Posaunenchöre, ihre Entstehung im Westfälischen
und die prägenden Personen in diesem Jahrhundert, Johannes
Kuhlo und Wilhelm Ehmann. Wie sieht und hört sich die Arbeit eines Posaunenchors an? Wie überall hat sich auch in den Posaunenchören in den letzten Jahrzehnten einiges verändert. Das veränderte Instrumentarium - u. a. Trompeten statt Flügelhörner - wurde bereits erwähnt. In der Literatur gibt es mittlerweile Bearbeitungen für Posaunenchöre aus fast allen Bereichen der Musik. Spirituals, Gospels (geistliche Lieder aus Amerika), Bearbeitungen zu neuen Liedern des Gesangbuches sind in den letzten 5-10 Jahren in großer Anzahl für die Posaunenchöre erschienen. Das heißt, stilistisch gibt es eine musikalische Breite wie noch nie, was von den ausführenden Bläserinnen und Bläsern wiederum ganz unterschiedliche Fähigkeiten auf ihren Instrumenten abverlangt. Ein Stück von Bach klingt anders wie eines von Mendelssohn oder wie ein Spiritual aus Amerika. Entsprechend muß es auch verschieden gespielt werden. Dazu braucht es unterschiedliche Spieltechniken, die erst gelernt werden müssen. Damit sind wir beim Spielen eines Blechblasinstruments angelangt. Um ein solches Instrument zu beherrschen, ist es Voraussetzung, sich zuerst einmal die musikalischen und bläserischen Fähigkeiten anzueignen, den dann erreichten Stand zu halten und möglichst weiter auszubauen. Das bedeutet, eine regelmäßige Beschäftigung mit dem Instrument ist notwendig, soll es auch für die Zuhörer gut klingen. Tägliches Üben, Besuch von Lehrgängen gehören dazu, bis ein Jungbläser nach 3-4 Jahren die Literatur im großen Chor mitspielen kann. Es bedarf demnach sehr viel Fleiß, Zeit, Ausdauer und Motivation für einen Jungbläser - und für seine Eltern! - bis er dieses bläserische Niveau erreicht hat. Die verschiedenen Stilrichtungen spielen zu können, macht andererseits auch viel Freude. Zum Teil geschieht dies in Sondergruppen des Posaunenchors, beispielsweise in den Jungbläsergruppen, im "Kleinen Chor" oder im Posaunenquartett. Aus der Vielfalt der Musikrichtungen und Sondergruppen ergeben sich die unterschiedlichen Arbeits- und Einsatzmöglichkeiten des Chores. |
"Wir haben
Gottes Spuren festgestellt -
komm getrost mit auf den Weg"
Georg Bießecker
Quellen:
Gehrke, Holger: Posaunenchöre unterwegs; Bremen 1997
Jäckle, Karl: Bibel und Posaunenchor; Bad Dürrheim 1995
| Schnabel,Wolfgang: | Die Entwicklung der Posaunenchöre in Deutschland; Göttingen 1993 |
Rückbesinnung
Wovon lebt ein evangelischer Posaunenchor?
Wer nach den Lebensquellen fragt, darf nicht am Äußerlichen hängen bleiben. Er muß tiefer graben. Wer nach dem Lebensstrom eines Posaunenchores fragt, der muß unwillkürlich nach den Quellen fragen, aus der eine Gemeinde schöpft. Denn für einen evangelischen Posaunenchor ist der "Sitz im Leben" die Gemeinde. Aus ihr stammen seine Mitglieder. Von ihr her erfahren Bläserinnen und Bläser Auftrag und Ziel - die geistliche Motivation.
Sie ist die Voraussetzung für die Treue und Zuverlässigkeit der Einzelnen. Sie ist ausschlaggebend für den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl des ganzen Chores. Das wiederum setzt Dynamik, Offenheit und lebendiges Fortschreiten einer Gemeinde voraus, die aus der Mitte des Gottesdienstes her lebt.
So ist für den Posaunenchor das Blasen im Gottesdienst eine lebensnotwendige Aufgabe und für die Gemeinde eine Bereicherung ihrer Verkündigung. Ein Bläser des Posaunenchores drückte es so aus: "Der Posaunenchor - das einladende Werbeplakat einer Gemeinde für Menschen, die den Kontakt zu ihr verloren haben."
Für diese Aufgabe in der Gemeinde bedarf es der bläserischen Fähigkeit und Motivation. Sie kann eingeübt und geschult werden. Dabei sind Erfolgserlebnisse und Fortschritte in der Beherrschung deines Blechblasinstrumentes für den einzelnen Bläser / die einzelne Bläserin äußerst wichtig. Sie finden in der Freude am Blasen und in der Zähigkeit des Übens ihren Niederschlag.
So lebt der Posaunenchor von beidem, von der geistlichen und bläserischen Motivation seiner Mitglieder. Beide Motivationen bedingen sich wechselseitig. Sie sind dynamisch - im Wechsel zwischen Auf und Ab und bedürfen ständiger Verstärkung.
Diese Verstärkung erfolgt durch den Chorleiter / die Chorleiterin. Bei ihm / ihr spielen die persönliche Glaubenshaltung, Offenheit und Verständnis, aber auch die Fähigkeit, musikalische Visionen in bläserisches Können umzusetzen, eine entscheidende Rolle.
Wird er / wird sie einen Posaunenchor immer wieder zu neuen Ufern und Höhepunkten führen können? -
Wird es im Posaunenchor immer wieder zu neuen geistlich-bläserischen Aufbrüchen kommen, die die Mitglieder und auch andere begeistern? -
Nur in der Begeisterung und im persönlichen Engagement werden Höhen und Tiefen, Schwierigkeiten und Sorgen (auch Nachwuchssorgen) überwunden.
Von dieser Begeisterung lebt ein evangelischer Posaunenchor. Mit ihr wird er seinen eigenen Identität im Lobamt der Kirche gerecht: "Lobet den Herrn mit Posaunen!"
Wolfgang Schade
Laer, Juli 1998 ........... gesehen, für gut
befunden und geklaut von der Website des Posaunenchores Bad
Oeynhausen. Danke
zuletzt bearbeitet 20.12.01 OK